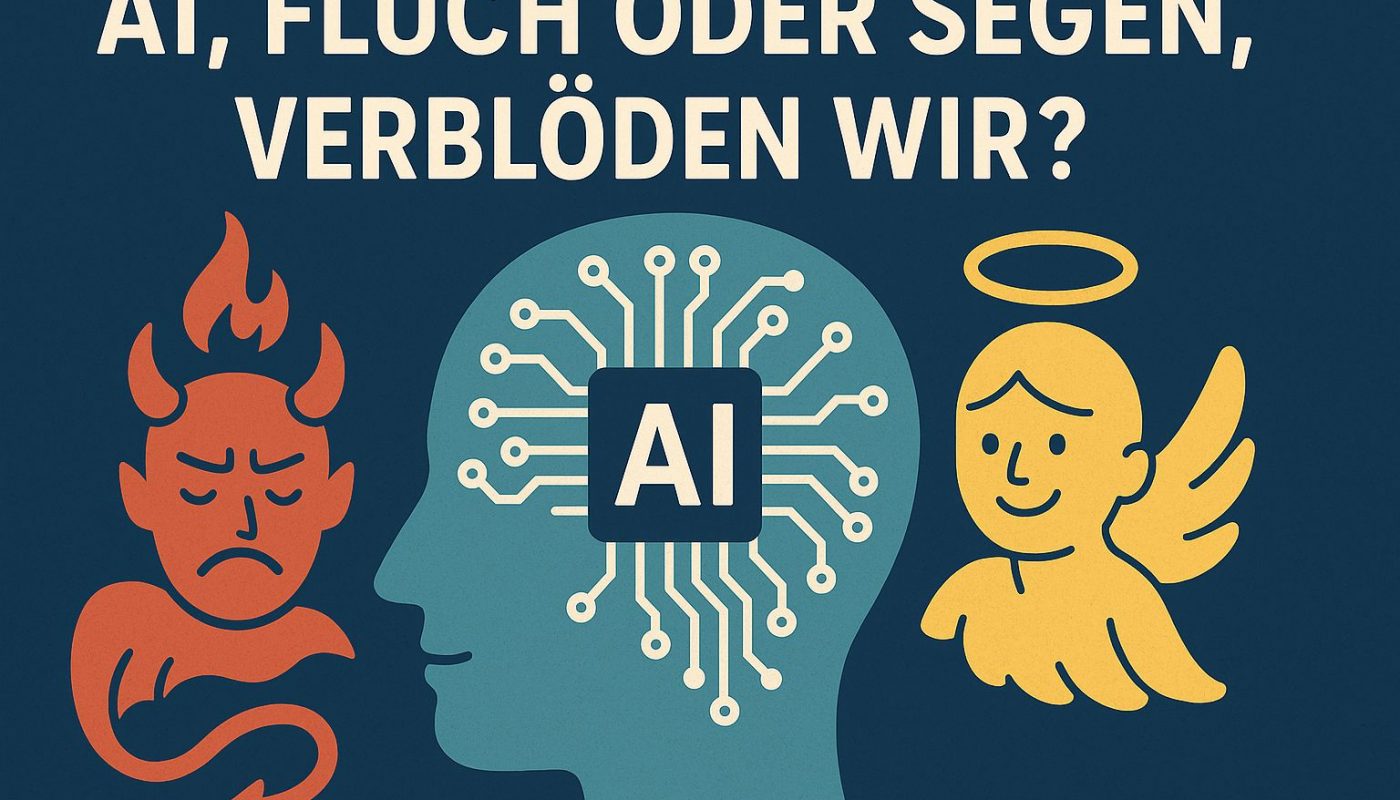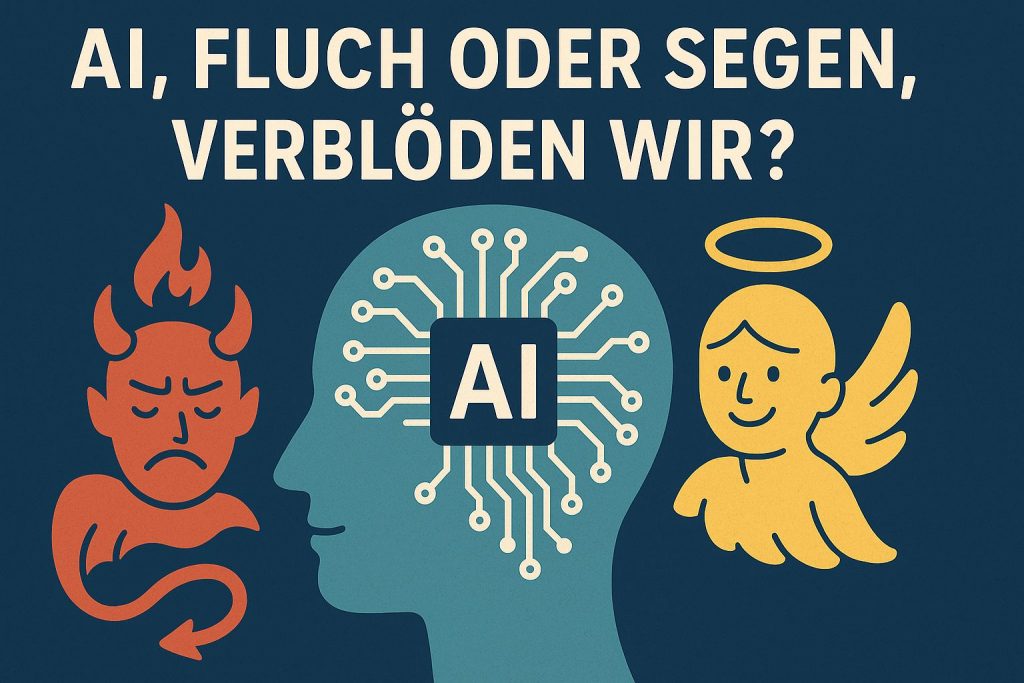
Künstliche Intelligenz bezeichnet Systeme, die mit grossen Datenmengen trainiert werden, um Muster zu erkennen, zu lernen und Prognosen abzuleiten. Diese Systeme analysieren nicht nur Informationen, sondern schlagen auch konkrete Handlungen vor, also Entscheidungen. Damit wird KI zu einem stillen „Mitentscheider“ in unserem Alltag.
Der grosse Vorteil: KI kann in kürzester Zeit riesige Datenmengen analysieren, präzise Muster erkennen und daraus Empfehlungen ableiten, datenbasiert, emotionsfrei und effizient. Das spart Zeit und schafft Orientierung, vor allem in komplexen Situationen.
Doch diese Effizienz hat ihren Preis: Wenn wir uns zu sehr auf KI-Systeme verlassen, ohne deren Logik oder Herkunft zu verstehen, laufen wir Gefahr, unsere eigene Urteilsfähigkeit zu verlernen.
ChatGPT & Co.: Hilfreiches Werkzeug oder Denkfaulheit?
Systeme wie ChatGPT beeindrucken durch sprachliche rafinesse und schier unendliches Wissen. Viele junge Menschen nutzen KI heute ganz selbstverständlich, für Referate, Bewerbungen, Mails, ja sogar für Liebesbriefe. Doch das wirft Fragen auf: Müssen wir überhaupt noch selbst denken, recherchieren, abwägen?
Natürlich darf und soll man sich Unterstützung holen, auch früher haben wir Lexika und Wikipedia verwendet. Der entscheidende Unterschied liegt heute im Grad der Automatisierung: ChatGPT liefert fertige Texte auf Knopfdruck. Es vermittelt Sicherheit, auch wenn Inhalte fehlerhaft, veraltet oder einseitig sind. Wer blind übernimmt, statt kritisch zu prüfen, läuft Gefahr, seine Selbstständigkeit zu verlieren.
KI Tools wie ChatGPT argumentiert plausibel, aber nicht immer korrekt. Es kann halluzinieren, also Dinge erfinden. Die Verantwortung für das Endprodukt liegt weiterhin bei uns.
Fazit: KI wie ChatGPT ist ein starkes Werkzeug, aber kein Ersatz für eigenes Denken. Kritische Medienkompetenz wird wichtiger denn je. Wer alles googelt (oder promptet), weiss noch lange nichts.
Verlernen wir das Denken?
Kritiker:innen befürchten, dass durch die permanente Verfügbarkeit „intelligenter“ Systeme unsere Fähigkeit zur Reflexion, zum Zweifeln und Hinterfragen verkümmert. Was früher ein mühsamer Lernprozess war wie z.B. Argumente bilden, recherchieren, feilen, wird nun durch Instant-Antworten ersetzt. Für Schulen, Universitäten und Arbeitgeber:innen bedeutet das: Nicht mehr Wissen allein zählt – sondern die Fähigkeit, es zu prüfen, einzuordnen und anzuwenden.
Der gesellschaftliche Diskurs darf deshalb nicht bei der Frage stehen bleiben: „Was kann KI?“, sondern muss lauten: „Was wollen wir Menschen noch selbst können?“
KI im Konsum: Wie Zalando unsere Wahl trifft
Die meisten Menschen begegnen KI im Alltag, ohne es zu merken – besonders beim Konsum. Streaming-Dienste wie Netflix oder Spotify schlagen Serien oder Songs vor, die auf unseren bisherigen Vorlieben basieren. Online-Shops wie Amazon oder Zalando präsentieren uns personalisierte Angebote, die perfekt zu unserem Klickverhalten passen.
Das Ergebnis: Wir kaufen, was uns gefällt, oder doch was uns gefallen soll? Empfehlungen wirken subtiler als klassische Werbung, doch sie steuern unsere Aufmerksamkeit und beeinflussen unser Verhalten. Auch hier entscheidet KI mit, meist unsichtbar im Hintergrund.
Weiterführende Links:
FAZ – KI Haftungsfalle
Stern – KI weis alles