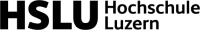Es gibt verschiedene Vorgehensweisen, um in Suchinstrumenten (Datenbanken, Bibliothekskatalogen und Suchmaschinen) eine Suche zu starten. Eine der bekanntesten Methoden ist das Schneeballsystem:
Schneeballsystem
Beim Schneeballsystem setzt du an der Information oder Quelle an, die du bereits zu deinem Thema gefunden hast.
- Dies kann z.B. die zitierte Literatur im Anhang deiner Quelle sein. In dem Fall sollte die Publikation möglichst aktuell und relevant sein, da du über die Referenzen die wichtigsten älteren Publikationen zum Thema finden kannst.
- Ausgangspunkt für diese Recherchestrategie können Werke aus einer Literaturliste deines Kurses sein oder Hinweise von Dozierenden und anderen Fachleuten. Datenbanken wie z.B. „Web of Science“ bieten bereits eine Referenzliste für die gefundenen Artikel an, wodurch die zitierte Literatur direkt verknüpft ist.
- Datenbanken wie „Web of Science“ und „Google Scholar“ machen es auch möglich in der Zeitspanne vorwärts zu suchen. So gelangst du zu den aktuelleren Publikationen aus deinem Themengebiet.
Ein weiterer Ausgangspunkt für die Suche nach dem Schneeballprinzip kann auch der/die Autor*in sein, denn oft arbeiten diese an dem jeweiligen Forschungsgegenstand weiter.
- In vielen wissenschaftlichen Datenbanken und auch bei Google Scholar sind Autor*innen direkt mit ihren Publikationsprofilen verlinkt.
- ORCID (Open Researcher and Contributor ID) bietet eine eindeutige Kennung für Forschende. Darüber lassen sich ihre Publikationen und Forschungsaktivitäten eindeutig zuordnen – auch wenn sie unter verschiedenen Namensvarianten veröffentlicht wurden. Viele Datenbanken und Bibliothekskataloge binden ORCID-Profile direkt ein.
- Eine weitere Möglichkeit bietet die Plattform ResearchGate, ein soziales Netzwerk für Wissenschaftler*innen, auf dem Publikationen geteilt und über Stichwörter gezielt durchsucht werden können.
- Falls du dort nicht fündig wirst, lohnt sich auch ein Blick auf die Instituts- oder Hochschulseite der Forschenden, wo aktuelle Projekte und Publikationslisten oft frei zugänglich sind.
Wenn sich beim Lesen und Auswerten der gefundenen Literatur zeigt, dass der Anteil der neuen Information zunehmend geringer wird, kann die Recherche abgebrochen werden.
Weitere Strategien sind z.B.:
- Trial and Error
Diese Methode bietet sich an, wenn das Thema für dich noch relativ neu ist Bei der Recherche mittels Trial and Error verwendet man Stichwörter und arbeitet mit Verknüpfungen und Abkürzungen der Suchbegriffe (mit Booleschen Operatoren und Trunkierungen). So lässt sich assoziativ und flexibel recherchieren. Zu Beginn der Recherche wird eine Stichwortsuche über alle Felder eines Katalogs, einer Datenbank oder einer Internet-Suchmaschine hinweg gemacht. So werden alle wichtigen Suchfelder gleichzeitig durchsucht: Autor, Titel, Schlagwort, Abstract etc. Auf diese Weise erhält man in der Regel eine sehr grosse Treffermenge, die man auf die wichtigsten Titel durchschauen kann. Die Treffermenge kann nach bestimmten Kriterien wie Sprache, Jahr, Publikationstyp etc. gefiltert werden, so dass am Schluss eine sinnvolle Treffermenge übrigbleibt. Diese Art von Suche wird in Katalogen und Datenbanken auch eingesetzt, um die relevanten Schlagwörter zu finden. Die einschlägigen Titel können auf ihre Schlagwörter hin untersucht werden. Mit diesen Schlagwörtern kann die Recherche im Schlagwortfeld strukturiert weitergeführt werden. - Systematische Recherche nach Themenblöcken
Teile dein Thema in Unterthemen auf und recherchiere diese Schritt für Schritt.
Beispiel: Beim Thema Mediennutzung von Jugendlichen könntest du zunächst nach Mediennutzung, Fernsehkonsum, Internetnutzung, Computerspiele oder Chatten suchen. Anschliessend verknüpfst du die Suchanfragen, um die Schnittmenge der relevanten Inhalte zu erhalten. - Strukturierte Recherche mit kontrolliertem Vokabular
Bei einer strukturierten Recherche verwendet man den Thesaurus einer Datenbank und sucht über Schlagwörter. Die Suchbegriffe werden über Indices (z.B. Schlagwort- oder Autorenindex) eruiert. Dank des normierten und kontrollierten Vokabulars gelangt man so zielgerichtet zu verlässlichen Resultaten und vermeidet unpassende Treffer. Diese Art von Suche ist nur in klassischen Bibliothekskatalogen und Fachdatenbanken möglich. Neuere Suchinstrumente wie swisscovery oder SpringerLink kennen kein kontrolliertes Vokabular mehr.
Eine Anleitung für Studierende zur Systematischen Recherche hat Marius Metzger von der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit erstellt: Anleitung-Recherchieren