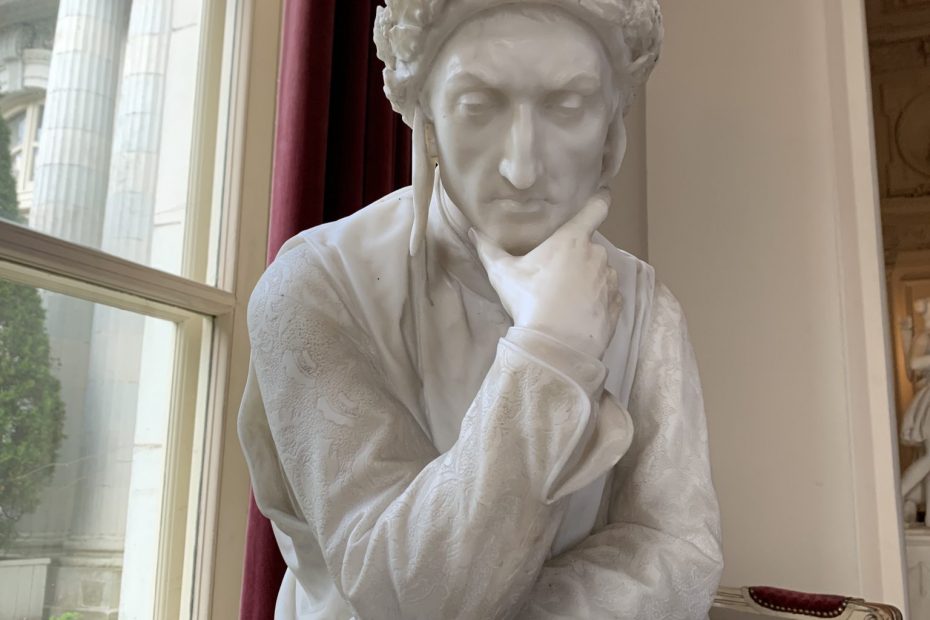Dozierende wünschen sich Studierende, die sich aktiv mit den Inhalten auseinandersetzen. Nun, „Jedes Lernen ist aktiv“, sagt Josef Buchner von der Pädagogische Hochschule St.Gallen – und trifft damit einen Nerv. Denn der Begriff aktives Lernen wird in der Hochschullehre häufig verwendet, bleibt aber oft unscharf. Um besser zu verstehen, was mit aktivem Lernen gemeint ist – insbesondere im Umgang mit Lernmaterialien – lohnt sich ein Blick auf die kognitive Dimension des Lernens. Diese Dimension richtet den Fokus darauf, wie intensiv sich Lernende mit den Inhalten auseinandersetzen, wie sie mit den Materialien arbeiten und wie sich diese Form des Engagements gezielt fördern lässt. Eine systematische Orientierung bietet dabei das ICAP-Framework.
Das ICAP-Framework (Chi & Wylie, 2014) liefert einen strukturierten Ansatz, um kognitives Engagement zu erfassen und gezielt zu fördern. Es unterscheidet vier Formen kognitiver Aktivität, die jeweils mit beobachtbarem Verhalten verknüpft sind und unterschiedliche Wissensveränderungsprozesse abbilden:
| Lernform | Beschreibung | Aktivitäten |
|---|---|---|
| Passiv | Informationen aufnehmen, ohne sich gedanklich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen | Zuhören, Lesen, Anschauen |
| Aktiv | Sich bewusst mit dem Inhalt beschäftigen, ohne ihn inhaltlich zu verändern | Notizen machen, Lösungsschritt kopieren, Video stoppen |
| Konstruktiv | Eigene Gedanken entwickeln und bestehende Informationen erweitern | Concept Map erstellen, Fragen stellen, Erklären |
| Interaktiv | Perspektiven austauschen und fremde Sichtweisen in das eigene Verständnis integrieren | Argumentieren, Peer-Diskussion |
Nehmen wir als Beispiel einen digitalen Text. Ein und derselbe Text kann – abhängig von der Lernaktivität – unterschiedliche Formen des Lernens ermöglichen.
- Wird der Text still gelesen, handelt es sich um eine passive Lernform – Informationen werden aufgenommen, aber nicht weiterverarbeitet.
- Wenn Studierende beim Lesen bestimmte Stellen markieren oder hervorheben, zeigt sich ein aktives Verhalten – sie interagieren mit dem Material, ohne es zu verändern.
- Werden eigene Notizen gemacht, Zusammenfassungen geschrieben oder Fragen formuliert, entsteht ein konstruktiver Zugang – neue Bedeutungen werden geschaffen und das Verständnis vertieft.
- Und wenn Inhalte mit einer Kollegin diskutiert werden, wird der Lernprozess interaktiv – durch den Austausch entstehen neue Perspektiven und Einsichten.
Damit Studierende sich auf Lernaktivitäten einlassen, braucht es mehr. Die Interaktion mit Lernmaterialien ist ein wesentlicher Bestandteil von Bildung – nicht als schlichte Informationsaufnahme, sondern als innere didaktische Konversation mit dem Inhalt, bei der Studierende in einen gedanklichen Dialog treten, hinterfragen, verknüpfen und reflektieren (vgl. Moore, 1989). Damit dies gelingt, müssen Lehrende die Inhalte gezielt didaktisch aufbereiten. Lernmaterialien sollten durch instruktive Elemente wie Erklärungen, Fragen, Hinweise oder Aufgabenstellungen angereichert werden. Erst durch diese didaktische Aufbereitung werden sie zu einem Lernmaterial, das zum Denken anregt und die individuelle Auseinandersetzung mit dem Inhalt fördert.
Besonders spannend ist die vierte Stufe des ICAP-Modells: Interaktiv. Lernen entsteht hier durch den Dialog – nicht nur mit anderen Menschen, sondern gemäs Autorinnen auch mit intelligenten Systemen (2014). Zentral ist, dass beide Partner konstruktiv agieren und Wissen produzieren. KI-Agenten wie Chatbots oder digitale Tutoren können nach dieser Definition als kognitive Partner fungieren, die Rückfragen stellen, Perspektiven anbieten und Denkprozesse anregen. In diesem Zusammenhang lohnt sich ein Blick auf die sokratische Gesprächsmethode, die auch im Kontext von Generativer KI bereits erforscht wurde (vgl. Opper, 2023). Aus dieser Perspektive sind Lernmaterialien nicht als vorbereitete, statische Informationsquellen zu verstehen, sondern als lebendige Wissensräume.
Aktives Lernen ist ein Prozess der kognitiven Auseinandersetzung mit Inhalten – und das ICAP-Framework hilft, diesen Prozess sichtbar und gestaltbar zu machen.
Wer lernen möchte, wie solche Impulse in digitale Lernmaterialien eingebaut werden können, kann am Online-Kurs „Digitale Materialien für aktives Lernen gestalten“ teilnehmen. Der Kurs bietet praktische Ansätze und konkrete Beispiele für die Umsetzung im eigenen Lehrkontext. Der Kompaktkurs startet am 27. Oktober, dauert 8 Wochen und findet online statt. Weitere Informationen und Anmeldung finden Sie hier.
Quellen:
Buchner, J. (2019, März 15). Lernen mit Medien: Instruktionspsychologische Grundlagen – aktives/passives Lernen? [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=18in5d8NfIY
Abgerufen am 24.09.2025
Chi, M. T. H., & Wylie, R. (2014). The ICAP Framework: Linking Cognitive Engagement to Active Learning Outcomes. Educational Psychologist, 49(4), 219–243. https://doi.org/10.1080/00461520.2014.965823
Moore, M. G. (1989). Editorial: Three types of interaction. American Journal of Distance Education, 3(2), 1–7. https://doi.org/10.1080/08923648909526659
Abgerufen von https://www.researchgate.net/publication/237404371_Three_Types_of_Interaction
Opper, K. (2023). Im Sokratischen Dialog mit KI. e-teaching.org.
https://www.e-teaching.org/etresources/pdf/erfahrungsbericht_2023_opper_im-sokratischen-dialog-mit-ki.pdf
Abgerufen am 30.09.2025
Bild: CC0 licensed photo by Jonathan Desrosiers from the WordPress Photo Directory.