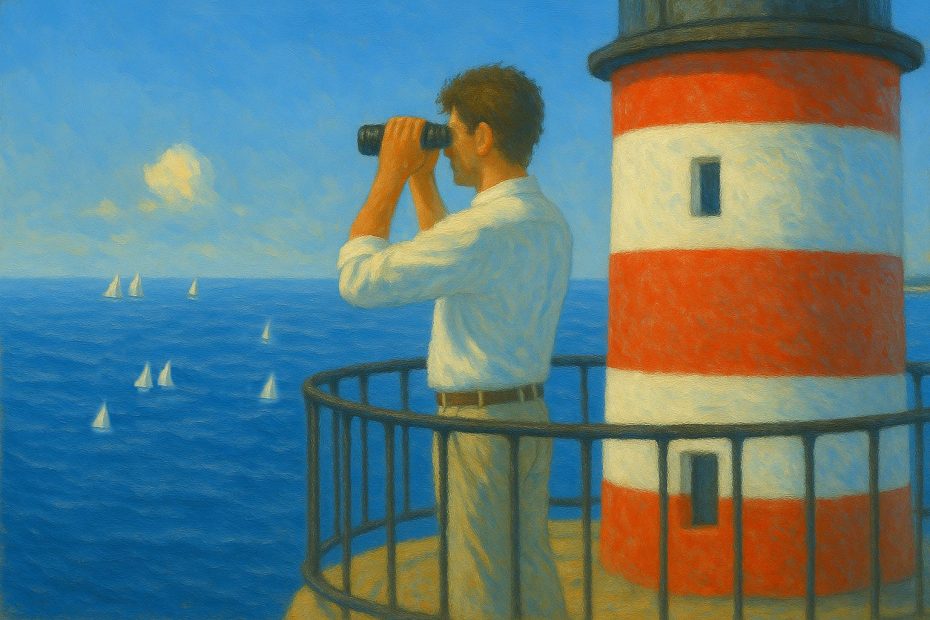Das Programm «E-Tutor*innen@hslu-sa“ richtete sich an Erstsemester-Studierende des Departements Soziale Arbeit und wurde von Studierenden höherer Semester, den sogenannten E-Tutor:innen, begleitet. Ziel des Programms war es, das Selbstmanagement und die Selbstwirksamkeit der Studierenden zu stärken und ihnen Werkzeuge sowie Strategien für selbstständiges Lernen an die Hand zu geben.
Für das Programm wurden vier E-Tutor:innen rekrutiert. Sie absolvierten ein Schulungsprogramm, das aus Online-Selbstlerneinheiten, Präsenzveranstaltungen und Webinaren bestand. Nach Abschluss der Schulung führten die E-Tutor:innen eigene Tutoratskurse für Studierende – sogenannten Tutand:innen – durch.
Im zweiten Beitrag unserer Blogreihe spricht Rike Hanke vom ZLLF mit Aaron Rhyner, Koordinator des E-Tutoratsprogramms, über seine Erfahrungen.
Bilanz
Schaut man auf die Zahlen, dann war das E-Tutoratsprogramm ein voller Erfolg. Fast die Hälfte der Erstsemester-Studierenden hat sich angemeldet. Wie fällt deine Bilanz des Projekts aus?
Für mich als Koordinator war es ein richtig spannendes Projekt. Aber auch sehr arbeitsintensiv. Es gab zwei wesentliche Teile, in denen ich gefordert war: das eine war die Koordination. Es fiel viel Administratives an wie z.B. die Bewerbungsphase, der Rekrutierungsprozess, die Durchführung der Schulungen… Wir hatten nicht mit so vielen Anmeldungen seitens der Studierenden gerechnet. Daher musste ich kurzfristig neue Zuteilungen machen. Die Gruppen waren dann auch grösser als geplant, zehn statt fünf und einzelne E-Tutor:innen erklärten sich glücklicherweise bereit, zwei Gruppen zu übernehmen und Paralleldurchführungen zu machen. Das war natürlich auch für die E-Tutor:innen herausfordernd. Ich muss sagen, dass wir ein super Team von E-Tutor:innen hatten.
E-Tutor:innen: Anstellung, Entlohnung, Schulung und Begleitung
Wie seid ihr bei der Rekrutierung vorgegangen?
Es war schwierig, ausreichend gute E-Tutor:innen zu finden. Wir wurden nicht überrannt, trotz Flyer, Poster und Plakaten. Am besten bewährt hat sich das direkte Ansprechen oder Anschreiben von Studierenden, die man als geeignet hält. Zusätzliche habe ich zwei Studentinnen unseres Departements, die von der Schweizerischen Studienstiftung gefördert werden, gefunden.
Wie war die Entlöhnung der E-Tutor:innen? Monetär oder mit ECTS-Punkten?
Das Projekt war von Swissuniversities mitfinanziert und so hatten wir ein Budget, um die E-Tutor:innen zu bezahlen. Allerdings war der Lohn nicht so üppig. In manchen Hochschulen gibt es ECTS-Punkte für das Teilnehmen am Tutoratsprogramm. Unsere E-Tutor:innen waren nicht an ECTS-Punkten interessiert, da sie kvor Ende des Studiums standen und keine ECTS-Punkte mehr brauchten.
Wie habt ihr die E-Tutor:innen geschult?
Die E- Tutor:innen haben zu Beginn den von euch erstellten ILIAS Selbstlernkurs «Selbstmanagement: to learn how to learn», eigenständig durchgearbeitet, in dem es zu jedem Baustein Lernmaterialien und Lernaufgaben gibt. Diese Materialien waren dann auch wertvoll bei den Tutoratskursen, die die E-Tutor:innen durchgeführt haben. Danach gab es zwei Präsenzveranstaltungen, in denen daran weitergearbeitet wurde.
Bei der ersten Präsenzveranstaltung ging es vor allem um Rollen und didaktische Methoden. Die zweite Schulung war dem Thema Micro Teaching gewidmet, wo die Vier dann eine Durchführung eines Tutoratkurses vor den anderen gemacht haben und Feedback darauf bekommen haben. Das war sehr gewinnbringend. In punktuellen Webinaren mit Hilde vom ZLLF konnten weitere Fragen geklärt werden. Da ging es dann z.B. um Herausforderungen in der Gruppe. Supervisionen wurden wenige angefordert. Die E-Tutor:innen haben sich gut selbst organisiert und sich untereinander ausgetauscht und abgesprochen. So haben sie gegenseitig von ihren Erfahrungen profitiert. Das lief ziemlich gut, da brauchte es in meiner Funktion nicht mehr viel Unterstützung.
Welches waren aus deiner Sicht die Herausforderungen bei den E-Tutor:innen?
Innerhalb von zwei Monaten wurden die Tutor:innen geschult. Nur kurze Zeit später standen die Tutor:innen vor einer Gruppe von Peers – zwar Studierende aus tieferen Semestern, aber dennoch Peers.
Herausfordernd waren für die E-Tutor:innen vor allem ihre eigene Rolle und die Erwartungen, die an sie gestellt wurden: Was müssen sie leisten? Wo sollten sie sich abgrenzen? Und was gehört nicht mehr zu ihrem Aufgabenbereich?
Das Thema der E-Tutorate war ja, Studierende beim Lernen und bei der Organisation ihres Studiums zu unterstützen. In der Praxis kamen jedoch auch andere Anliegen auf – etwa von neurodivergenten Studierenden, die sich eine Einzelberatung wünschten, oder von Studierenden, die spezifische Inhalte zu einem bestimmten Modul vertiefen wollten.
Hinzu kamen organisatorische Herausforderungen: Aufgrund der hohen Anmeldezahlen und kurzfristigen Nachmeldungen mussten die E-Tutor:innen teilweise zwei Gruppen gleichzeitig betreuen und auf Online-Formate umstellen. Manche boten ihre Schulungen sogar hybrid an. Zudem sprangen Studierende gelegentlich ab oder erschienen nicht, sodass immer wieder neu geplant werden musste.
Nach meinem Eindruck waren es eher äussere als inhaltliche Herausforderungen, mit denen die E-Tutor:innen konfrontiert waren.
Tipps für andere Hochschulen oder Departemente
Wenn andere Departement oder Hochschulen sich nun inspiriert fühlen und ein E-Tutoratsprogramm durchführen möchten, auf was sollten sie achten?
Ein Tipp bzgl. der Rekrutierung: wir hatten lange fast keine Anmeldungen seitens der Studierenden, die Werbung mit Plakaten und Mails hat nicht gut funktioniert. Der Scheidepunkt war dann das Vorstellen der E-Tutor:innen in einem Modul. Die Studierende haben dann verstanden, was ihnen das E-Tutorat für Vorteile bringt. So wurde der Kontakt hergestellt und viele Studierende haben sich daraufhin angemeldet. Es braucht also gar nicht so viel Aufwand bzgl. des Marketings.
Bezüglich der Koordination sollten ausreichend personelle Ressourcen und genügend Zeit eingeplant werden. Wir wurden regelrecht von Anfragen überrannt, hatten aber nur vier E-Tutor:innen rekrutiert – das war so nicht vorgesehen. Zum Glück erklärten sich einige von ihnen bereit, zwei Gruppen zu übernehmen. Ideal wäre es jedoch, einen Pool von E-Tutor:innen zu haben, auf den man flexibel zurückgreifen kann. Wünschenswert wäre auch mehr Vielfalt unter den E-Tutor:innen – etwa hinsichtlich Teilzeit- und Vollzeitstudium, Studienrichtung, Alter, Lebenswelt oder Migrationshintergrund. Das konnten wir alles nicht berücksichtigen. Da gäbe es Potenzial.
Das Tutorat sollte vom ersten Studientag an beginnen. Vor allem Erstsemester-Studierende brauchen nicht nur Unterstützung bei der Frage wie sie richtig lernen und welche Strategien es gibt, sondern auch bei der Auswahl der Module, beim Finden von Informationen, etc.
Gründe für ein Tutorat
Warum braucht es deiner Meinung nach ein Tutorat an Hochschulen?
Es wird an der Hochschule viel vorausgesetzt, das gar nicht so viel mit der jeweiligen Studienrichtung oder dem Studiengang zu tun hat. Die ganze Eingewöhnung braucht Zeit, es braucht eine Art Hochschulsozialisation. Das kann zu Beginn sehr anspruchsvoll sein. Die einen kommen damit besser klar als die anderen und das kann zu Ungleichheiten führen.
Mit der neuen Reform und Curriculums-Überarbeitung an der Sozialen Arbeit geht es noch mehr Richtung Blended Learning. Hier müssen sich Studierende noch besser selbst organisieren, sich zurechtfinden. Da ist dann die Motivation und auch eine gute Organisation wichtig, um dranzubleiben und nicht den Anschluss zu verlieren. Es braucht mehr Unterstützung im Lernprozess. Ich glaube, dass das für eine Hochschule nur gewinnbringend sein kann, wenn ihre Studierende unterstützt werden. Gleichzeitig kann das Potenzial von guten Studierenden in den höheren Semestern genutzt und dadurch gefördert werden.
Persönliche Erkenntnisse
Was nimmst du persönlich mit aus dem Projekt?
Das Thema Selbstmanagementkompetenz ist omnipräsent, auch für uns Mitarbeitende ist das Thema relevant. Ich merke, dass ich manchmal mehr arbeite als ich eingeplant hatte. Oder dass ich gar nicht immer so super strukturiert bin. In den Selbstlerneinheiten von dem ILIAS Kurs bin ich dann auf das Pareto Prinzip gestossen. Ich hatte das schon einmal gehört, aber wieder vergessen. Und nun versuche ich es anzuwenden und zu schauen, ob es wirklich die 100% braucht oder nur das Tüpfelchen auf dem I ist. Ein pragmatischer Ansatz, um zu schauen wie viel Aufwand ich brauche, um ans Ziel zu kommen.
Ja, das stimmt. Die Techniken sind auch für uns als Mitarbeitende und Dozierende nützlich. Ich bin z.B. Fan von der Tomaten- oder Pomodoro-Technik.
Die ist auch spannend. In dem ILIAS Kurs habe ich viele interessante Techniken gelernt bzw. mir nochmals ins Gedächtnis gerufen. Die Selbstlerneinheiten mit den verschiedenen Bausteinen waren super. Da war auch noch die Diskussion, wieso diese nicht für alle zugänglich sind, sondern nur für die Studierende, die sich fürs E-Tutorat angemeldet haben.
Mittlerweile ist der ILIAS Kurs «Selbstmanagement: to learn how to learn» frei zugänglich und befindet sich im öffentlichen Raum auf unserer ILIAS Lernplattform. Auch ohne HSLU-Login kann man darauf zugreifen und die Bausteine bzw. Themengebiete durcharbeiten.
Möchtest du noch etwas hinzufügen?
Ich frage mich, ob wir alle erreicht haben. Haben wir wirklich die Studierenden erreicht, die vielleicht besonders Bedarf haben? Oder sind es die «üblichen Verdächtigen», also die Studierenden, die schon gut selbstorganisiert sind und noch besser organisiert sein wollen? Das wäre noch interessant herauszufinden.
Im nächsten Beitrag berichten die zwei Tutor:innen, Ilona Greter und Loïc Wohlfarth, über ihre Erfahrungen und verraten uns mehr über Motivation, Herausfordernungen, Learnings und Wünsche…
————-
Illustration: Mascha Löhrer mit Hilfe von ChatGPT.