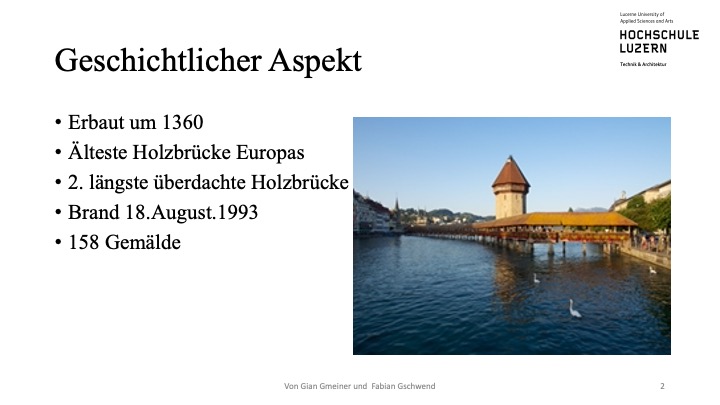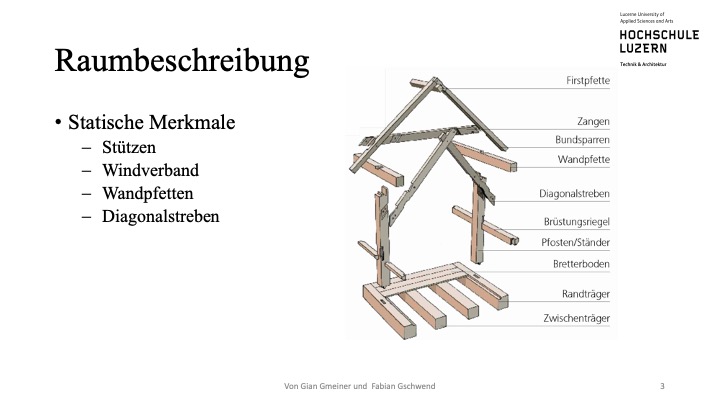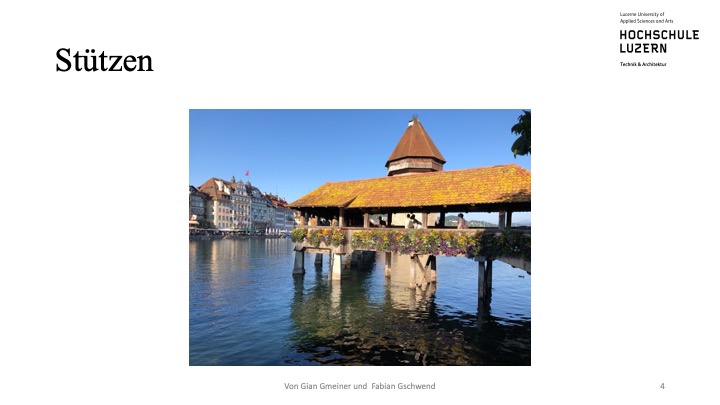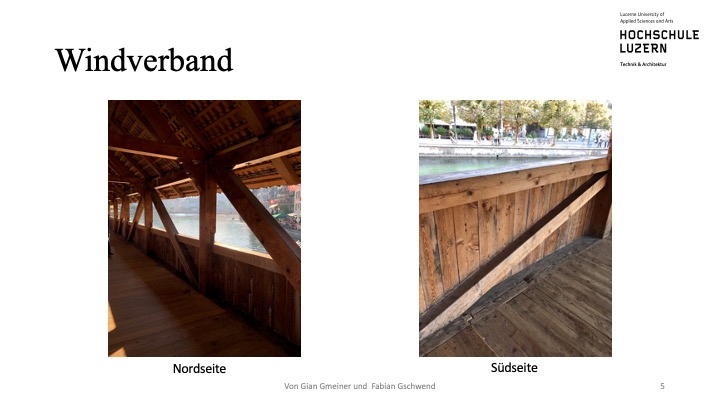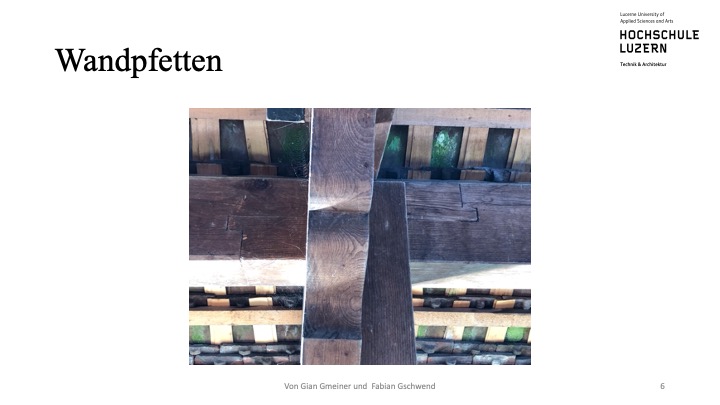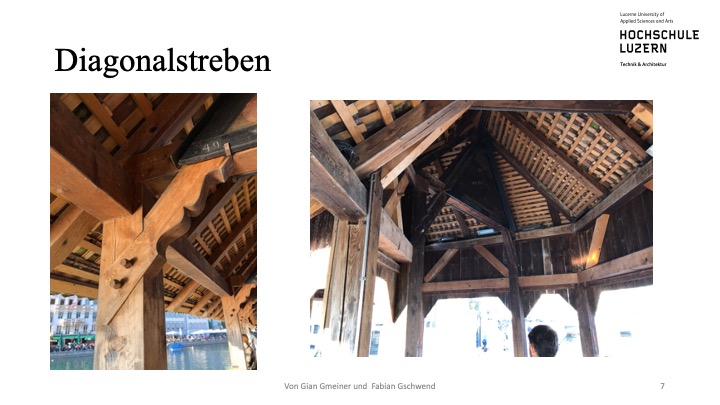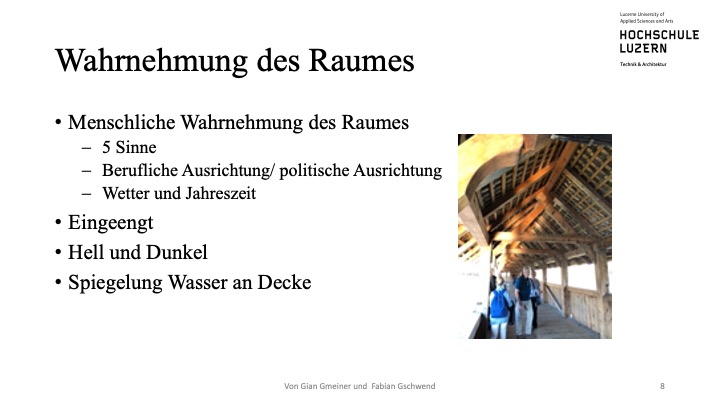Die Laborgasse auf dem Campus Technik & Architektur der Hochschule Luzern liegt in nord-südlicher Richtung zwischen dem Labortrakt Trakt 1 und den Unterrichtstrakten Trakt 2,3 und 4. Die Ausrichtung der Gebäude und entsprechend auch der Gasse wurde aufgrund der äusseren Einflüsse gewählt. Die Trakte im Osten und Westen haben den Zweck, die Lärmemissionen der Gleise und der Technikumstrasse für die Unterrichtstrakte in der Mitte möglichst klein zu halten. Die Gasse dient als Zugang zu den westlichen Eingängen Trakt 1 und den östlichen Eingängen der Trakte 2, 3 und 4. Da alle Eingänge befahren werden können, dient die Gasse ebenfalls als Anlieferung.
Räumlich kann die Gasse in drei Teile unterteilt werden. Der südliche Teil, von der Einfahrt bis zur ersten Fussgängerbrücke, ist der längste, jedoch auch schmalste Abschnitt. Aus platzgründen findet man dort lediglich die Strasse und eine kleine Rabatte mit Lichtpylonen. Die Rabatte zieht sich weiter bis unmittelbar vor die erste Fussgängerbrücke, welche die Trakte 1 und 2 verbindet. Im zweiten Abschnitt, einige Meter nach dieser Brücke, beginnt der Fahrradunterstand, welcher sich mit regelmässigen Unterbrüchen aufgrund Baumgruben bis ans Gassenende weiterzieht. Der letzte und zugleich kleinste Abschnitt, nördlich der zweiten Fussgängerbrücke, schliesst die Gasse ab.

Wenn man die heutige Laborgasse mit Bildern der Laborgasse von 1980 vergleicht, kann man einige Unterschiede festgestellen. Wo heute die schmale Rabatte mit modernen Lichtpylonen ist, war früher eine breite Rabatte mit kugelförmigen Leuchten. Die Rabatte musste vermutlich aufgrund der immer grösseren Durchfahrtsfahrzeuge verkleinert werden.
Der Fahrradunterstand nördlich der ersten Fussgängerbrücke wurde auch erst nachträglich gebaut. Auch dort war früher eine breite Rabatte, welche jedoch, abgesehen von den Baumgruben, komplett weichen musste.

Auch in Zukunft wird die Gasse der Hochschule erhalten bleiben. Die ersten Einblicke in das Projekt des neuen Campus Horw, wo in Zukunft auch die Pädagogische Hochschule Luzern untergebracht sein wird, zeigt, dass sich die Trakte rund um die Laborgasse nicht gross verändern werden. Eine Sanierung der Trakte wird jedoch auch eine Sanierung der Laborgasse zur Konsequenz haben.
ANALYSE LICHT
Wir haben versucht, die Atmosphäre des öffentlichen Raumes der Laborgasse zu erfassen und uns im Speziellen mit der Komponente Licht auseinanderzusetzen. Die Höhe von rund 24 Metern der Trakte 2, 3 und 4 bei einer Gassenbreite von 8 Metern setzen einen Passanten beinahe unter Druck. Dieses Volumen vermittelt die Atmosphäre einer Schlucht. Die gemessene Einstrahlung entsprechend Beleuchtungsstärkemessgerät Testo 540, betrug am 21.10.2021 um 17:00 Uhr 2300 – 2500 lux. Im Vergleich dazu kann man an einem hellen, sonnigen Tag im Freien 100`000 lux. erwarten. Im Schatten sind es rund 10`000 lux. Eine Studiobeleuchtung bringt immerhin noch rund 1000 lux. auf den Zähler.
Die Frage, ob das ganze architektonische Konzept denn nicht dem simplen Anspruch der Nutzung als Anlieferung und Zugang zu den Trakten 1- 4 genüge, ist natürlich berechtigt. Jedoch muss die heutige Architektengemeinschaft endlich erwachen und auch den öffentlichen Raum für die Menschen, deren sensibles Empfinden und deren Wohlbefinden, planen und bauen. Martina Guhls Fragestellung, ob der Aussenraum ein einladender und sinnlich anregender ist, einer mit Verweilqualität und Gestaltungsspielraum oder bloß der übrig gebliebene, mit Hinweisschildern und Verbotstafeln bestückte Restraum, soll Wegleitung bei Planung und Ausführung sein. Ein umfassendes Lösungskonzept für die Verbesserung des Licht – Raum – Erlebnisses ist die Idee die Schlucht – Atmosphäre auf eine erleichterte angenehme Fahrbahn aufzubauen.
Zum Beispiel, es kann eine halbtransparente Decke auf rund 4.20 Meter über der Lieferzone aufhoben werden. Diese sollte durch hochintensive LED-Strahler angestrahlt werden oder selbst leuchtend sein. Sinnvollerweise sollte der Strom dafür nachhaltig vor Ort produziert werden. Dies kann man mit eigenen Solaranlagen ermöglichen. Zusätzlich kann die Fassade punktuell von unten bestrahlt werden.
INTERVENTION
Die Laborgasse ist ein Ort wo sich Menschen üblicherweise nicht lange aufhalten. Es herrscht Hektik und die Gasse wird lediglich als Durchgangszone oder Abstellplatz benutzt. Wir haben uns mit dem Gedanken befasst, dass es schön wäre, wenn wir das Gegenteil mit unserer Intervention schaffen würden. Das heisst, es soll ein Ort werden wo sich Menschen gerne aufhalten und verweilen.
Unsere Intervention bezieht sich auf den Bereich zwischen den beiden Fussgängerbrücken der Trakte. In diesem Bereich möchten wir einen Aufenthaltsort für den Campus erstellen, welcher vor allem über die Sommermonate z.B. als Bar betrieben werden kann. Über den Winter kann der Bereich anderweitig als Aufenthaltszone genutzt werden. Diese Zone möchten wir mit Licht kennzeichnen, sodass sich der Platz vom Rest der Laborgasse hervorhebt.
Die Fahrradunterstände, welche durch die Intervention wegfallen, können hinter der oberen Gebäudebrücke platziert werden. Für die Anlieferung und den Transport ist der Bereich vor der unteren Gebäudebrücke geplant.


LÖSUNGSVARIANTE 1: NATÜRLICHES LICHT
Die erste Lösungsvariante beinhaltet ein Ausleuchten des Aufenthaltsraums mithilfe von natürlichem Licht. Der wesentliche Pluspunkt dieser Variante ist die Ökologie, da das Sonnenlicht zur Beleuchtung genutzt wird und so auf ein Ausleuchten mit künstlichem Licht zu grossen Teilen verzichtet werden kann.
Die Variante mit natürlichem Licht beinhaltet Spiegel an der Südfassade Trakt 3 und auf dem Dach Trakt 1. Dabei wird das Sonnenlicht nicht direkt auf die Gasse, sondern an die Fassaden entlang der Gasse geworfen. So leiten die schräg angebrachten Spiegel an Trakt 3 das Licht auf die Westfassade von Trakt 1 und die Spiegel auf dem Dach vom Trakt 1 das Licht auf die Ostfassade der Trakte 2 und 3.Bei der Analyse der Sonnenlaufband wurde ersichtlich, dass mit dieser Spiegelaufstellung im Sommer bis ungefähr 18:15 Sonnenlicht in die Gasse gespiegelt wird. Umso näher das Jahresende kommt, desto länger spiegeln die Spiegel die Gasse hell. Ab einem gewissen Zeitpunkt im Herbst wird während der ganzen Zeitspanne bis zum Sonnenuntergang das Licht gespiegelt. Dies geht den Winter durch weiter, bis im Herbst der gleiche Mechanismus in Umgekehrter Reihenfolge stattfindet. Mit dieser Variante wird die Gasse somit das ganze Jahr durch bis ungefähr 18:15 mit Sonnenlicht erhellt, im Herbst, Winter und Frühling sogar noch länger.
Die genaue Anordnung und Geometrie der Spiegel, das zu verwendende Material und auch allfällige zusätzliche Massnahmen wie Abdeckungen für die Spiegel zur Verhinderung von ungewollten Reflektionen werden in späteren Phasen ermittelt.

LÖSUNGSVARIANTE 2: KÜNSTLICHES LICHT
Die Variante 2 bezieht sich auf dekorative Lichtinstallationen. Der Zweck dieser Installationen ist nicht den Raum zu erhellen oder auszuleuchten, sondern eine Illusion der Raumbegrenzung zu schaffen.
Unsere Idee ist, künstliches Licht einzusetzen um die Gasse (vor allem nachts) optisch zu begrenzen/ zu unterteilen. Damit schaffen wir für unseren Aufenthaltsort eine optische Zonenbegrenzung. Diese Begrenzung kann nach oben zum Himmel eingesetzt werden, sowie zu den zwei offenen Seiten.