
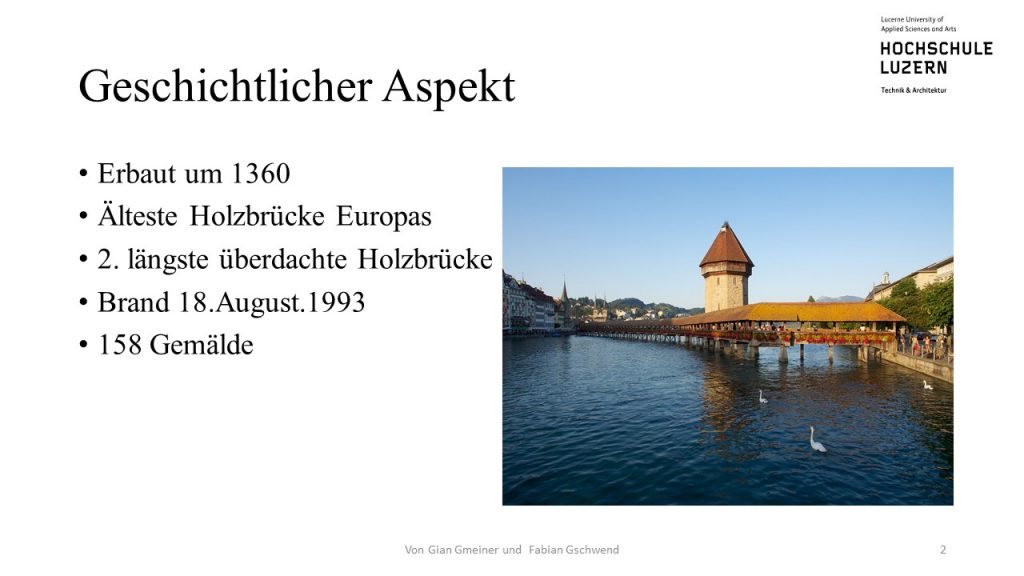
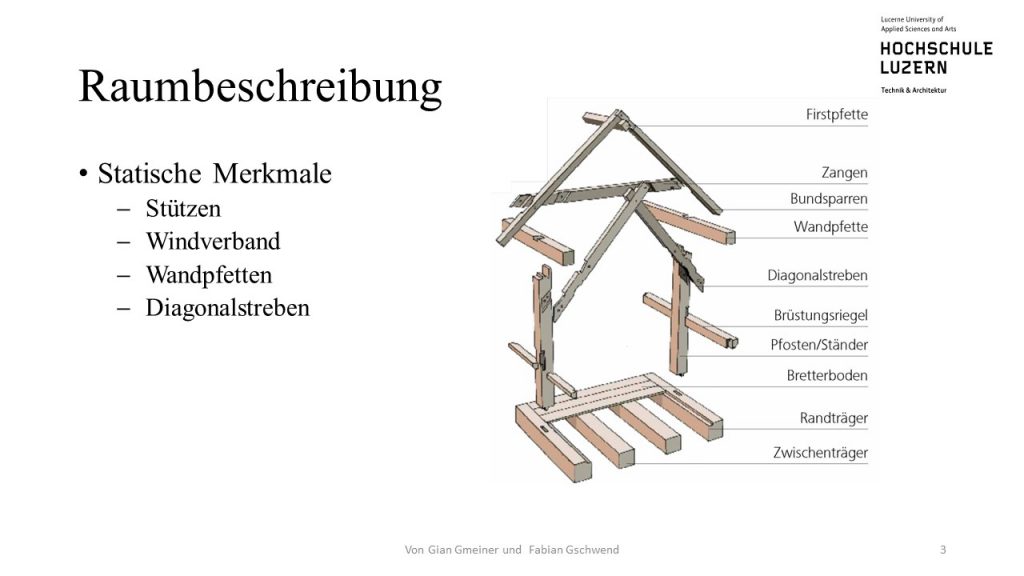
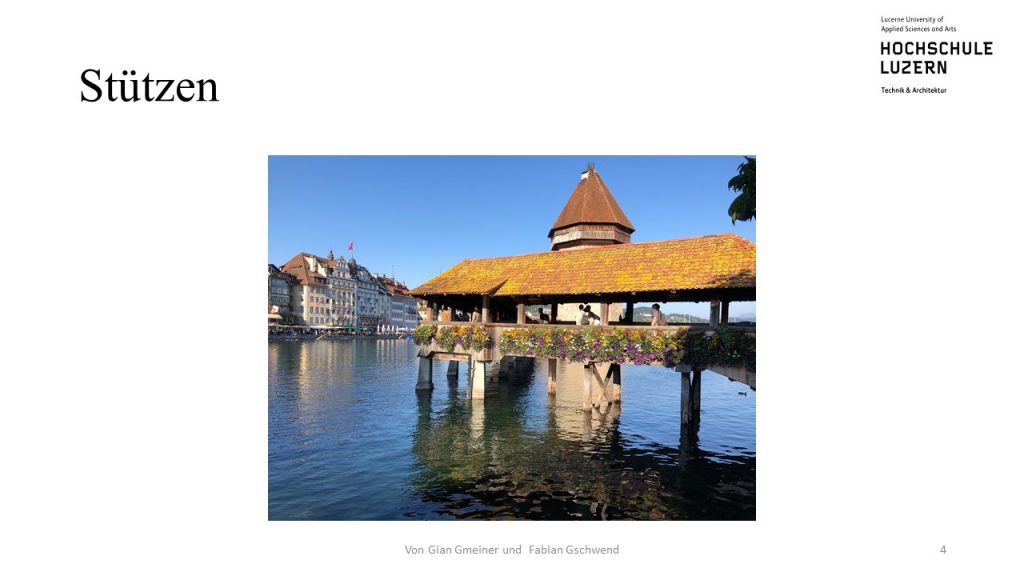

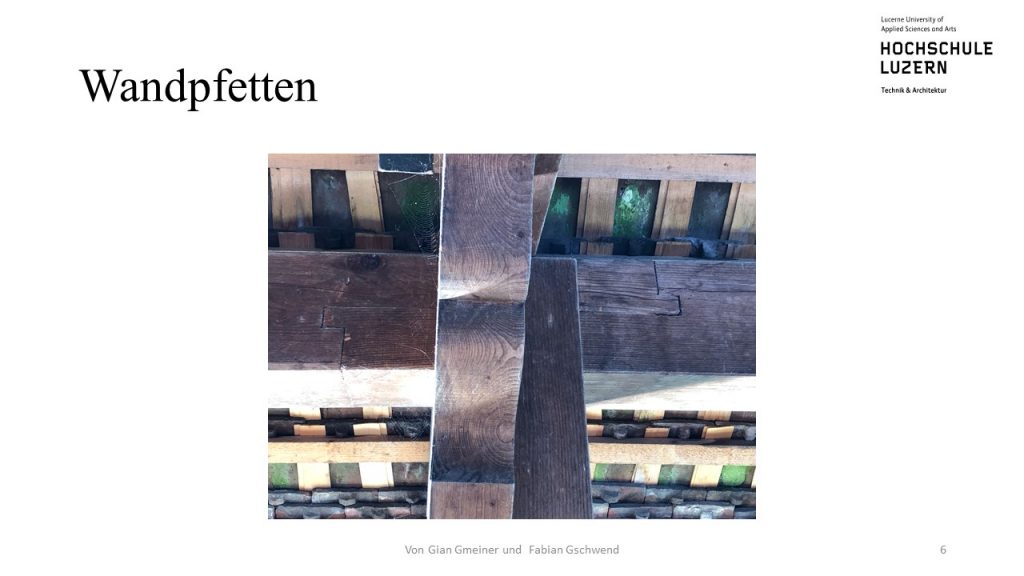
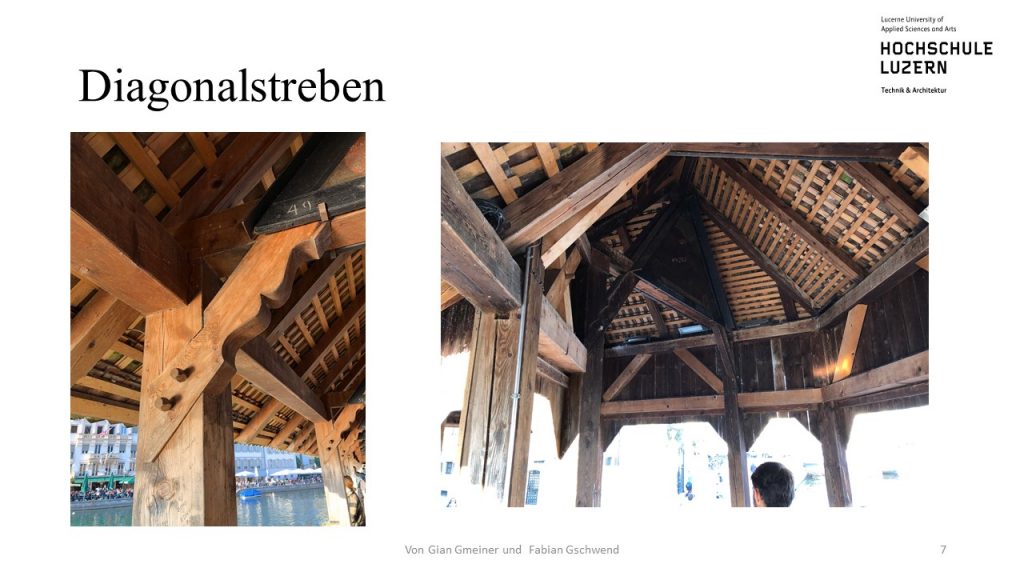
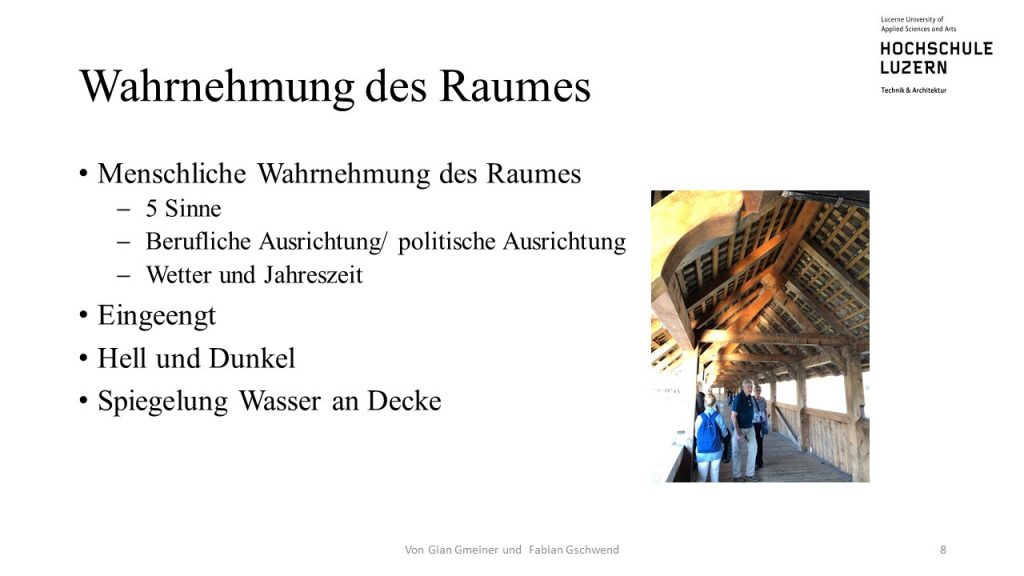
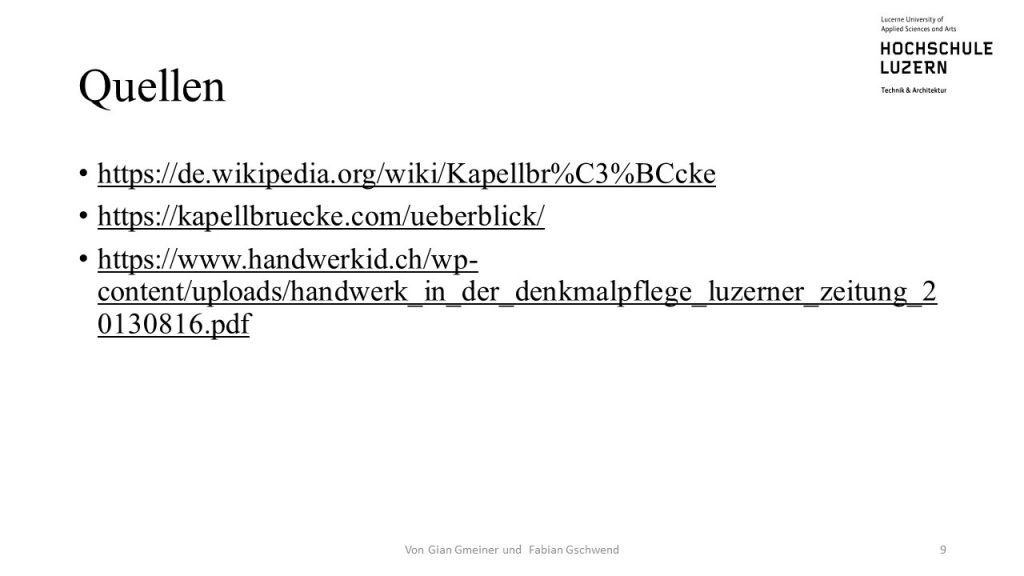
Hochschule Luzern Technik & Architektur
Nach einer kurzen Zugfahrt von Horw nach Luzern und einem raschen Fußmarsch erreichten wir den Frohburgsteg, der den Alpenquai mit dem Bahnhof verbindet.
Der erste Eindruck der geschätzt 100 m langen und 3 Meter breiten Fußgängerbrücke, die über die Gleise des regen Zugverkehrs der Stadt Luzern führt, wirkte auf mich etwas schäbig. Ich begann über die Brücke zu gehen. Die Sonnenstrahlen der Abendsonne warfen zwar viel Licht auf die Brücke, doch durch den grauen Stahl, die etwas heruntergekommenen Werbeplakate, die auf beiden Seiten der Wände befestigt waren, und die seitlich abstehenden Gitter, fühlte ich mich etwas eingeengt. Ich fragte mich, wozu diese komischen Gitter wohl gedacht sind? Die Abendsonne schien mit aller Kraft und tauchte die Brücke in warmes Sonnenlicht ein und zeichnete Schatten der massiven Stahlträger an die gegenüberliegende Seite. Jedoch konnte das Licht nur zwischen der Brüstung und der Decke auf den Gehsteig fallen, da die Brüstung aus Stahlblechen ist, die keinen Sonnenstrahl durchdringen lassen. Ich fasste an die Brüstung und fühlte die Wärme, die die Sonne an den Stahl abgegeben hatte. In diesem Moment wehte mir ein angenehmer Wind durchs Haar. Da der Gehsteig offen ist, kann dieser ungehindert durch die Brücke hindurch wehen.
Ich hielt kurz inne und blickte in die Ferne. Ich konnte den regen Bahnverkehr sowie die Schulen und Gebäude um den Bahnhof erblicken. Ich ging weiter und der Rauch von Zigaretten und das Parfüm der Fußgänger stieg mir in die Nase. Durch die ein- und ausfahrenden Züge, welche direkt unter der Brücke hindurchrasselten, und die klappernden Rollkoffer, die über den gewellten Stahlboden strichen, war es relativ laut. Die Atmosphäre wirkte durch diese vielen Einflüsse eher etwas bekümmert und unwillkommen auf mich.
Ich konzentrierte mich danach auf die Stahlkonstruktion der Brücke. Das Grundgerüst ist mithilfe von starken HEB-Trägern ausgebildet. Sie bilden Dreiecksformen rechts und links vom Gehsteig. Im Abstand von etwa 5 Meter sind vertikale Träger, dazwischen diagonale Träger. Die Brücke besitzt keinerlei Stützen unter dem Gehsteig, sondern hat nur je ein Auflager zu Beginn der Brücke und eines am Ende. Deshalb muss sie enorme Kräfte aufnehmen können, was die massiven HEB-Träger erklärt. Als Nächstes blickte ich an die Decke. In regelmäßigen Abständen sind quere HEB-Träger. An jedem ist jeweils eine Lampe montiert, die in der Nacht die Brücke mit Licht erfüllen. Zwischen den Trägern sind dicke, diagonale Stahlseile mit beweglichen Konstruktionen an die Ecken der massiven Stahlträger befestigt. Diese sind dazu da, auch bei starkem Wind die gesamte Stahlkonstruktion etwas beweglich zu machen. Damit der Durchgang von Regen und Schnee geschützt ist, befindet sich über der ganzen Konstruktion ein gewölbtes Wellblechdach. Die Runde Wölbung stellt vermutlich sicher, dass das Wasser sowie der Schnee vom Dach herunterfallen kann. Der Boden ist ebenfalls aus Stahl und ist mit Rillen versehen, in denen sich Kaugummis und anderer Schmutz festgesetzt haben.
Nachdem ich diese vielen Eindrücke der Brücke festgehalten hatte, schlenderte ich zurück Richtung Bahnhof und genoss die letzten warmen Sonnenstrahlen, die dieser Herbsttag bereithielt.
Der Mensch lebt von Bedürfnissen. Die Zielgruppen, welche die Kirche besuchen sind vielfältig und geht vom reinen Gläubigen, zum Neugierigen bis zum Touristen. Je nach kulturellem und sozialem Hintergrund ändert sich die Wahrnehmung dieser religiösen Baute. Subjektiv bekommt man beim Eintritt in die Kirche ein düsteres Gefühl, es gibt wenig Licht im Eingangsbereich. Für Personen die Krank sind und so laut der Architekturpsychologie eine anderes Wahrnehmungsempfinden haben, kann das Ganze sogar eine beängstigende Wirkung erzeugen. Man merkt, dass man sich in einem Rückzug Ort befindet. Für Gläubige sind die Erwartungen gross, es soll ein Ort der Kraft sein, Touristen hingegen warten auf prächtige Freskos im Barockstil. Im Eingangsbereich wird man sicherlich enttäuscht aber erst beim Erkunden der Kirche nimmt man den Sinn des Ganzen wahr. Erst dann erkennt man die Schönheit und den Sinn wie das Ganze konzipiert ist. Sobald man sich den Bänken und somit zur Mitte der Kirche nähert, hellt der Raum sich mehr und mehr auf was das Ganze einladender wirken lässt. Sitzend bekommt man das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Von da aus, sieht man wie der Altar am meisten erleuchtet wird. Die Wahrnehmung konzentriert sich auf den Altar, dort findet auch die Eucharistiefeier statt, der wichtigste Zeitpunkt eines Gottesdienstes. An sonnigen Tagen wird das Kirchenschiff durch das eintretende Sonnenlicht vom seitlichen Fensterband, welche die Ganze Kirche umgibt, erleuchtet. Auf einer Erhöhung über den Eingangsbereich befindet sich der Choorsaal. Im Gegensatz zum Rest ist der Raum gut beleuchtet. Grund dafür ist, da es an diesem Ort mehr um die Konzentration zum auf die Tätigkeit als Chorist geht und weniger um das Erlebnis/Erkunden der Kirche durch die verschiedene Beleuchtungsarten. Die verschiedenen Lichtverhältnisse haben viel damit zu tun wie und mit was für Materialien die Kirche gebaut wurde. Die ganze Konstruktion besteht hauptsächlich aus Nichtragenden Betonwände was das ganze wenig aufhält. Die 18 tragende Stützen sind mit schwarzem Fliessen bekleidet welche Boden und Decke verbinden. Der Boden besteht aus einem dunkelbraunen Laminat. Die oberen Seitenfenster welche bunt geschmückt sind, sind fast das einzige, welchen dem Raum mehr oder weniger Farbe geben, sie befinden sich eingeschlossen zwischen Decke und Betonwand und haben somit keine tragende Wirkung. Auf den seitlichen Betonwände gibt es einfache Fresko, welche die ganze Seitenwände umgehen und so die sonst langweiligen Betonwände etwas Farbe geben. Nebenaltäre und Beichtstühle befinden sich in Nischen, welche von aussen wie nebenschiffartige Segmente wahrgenommen werden können. Diese Räume werden auch mehr beleuchtet als der Innenraum selbst. Diese Art der Konstruktion ist widerspiegelt sich in der Art wie man mit Eisenbeton baut. Die Grundsätze dieser Baute sind das Wand, Säule und Dach die wesentlichen Elemente der Baute bilden. Das Kirchenschiff bildet zusammen mit dem Altar eine Einheit und soll laut dem Architekten Fritz Metzger das ganze Heiligtum aber auch Gemeinschaft sein. Das Ganze besteht aus einem Hauptteil nämlich die Oberkirche sowie von einem kleineren Teil im unteren Stock der Unterkirche. Der Aussenbereich besteht aus einem Weit Ausragenden Vordach welcher von Vier Stützen plus Innere Wand gehalten wird, welche wiederum auf dem Unteren Geschoss aufgelegt sind.
https://de.wikipedia.org/wiki/St.Karl(Luzern) (25.09.2021)
Raum 7 – Parkanlage Vögeligärtli Luzern
Kurz und knackig: Das Vögeligärtli ist ein umbauter öffentlicher Raum süd-westlich vom Hauptbahnhof Luzern. Als schöne grüne Parkanlage lädt dieser Raum zum verweilen ein. Koordinaten E=2’666’065/N=1’211’195

Wahrnehmung
Menschen plaudern, Kinder spielen, die Sonne scheint, auf der Gartenterrasse wird konsumiert, Studenten beobachten und noch vieles mehr, so ist das Vögeligärtli in Mitten der Stadt Luzern beispielsweise am frühen Abend des 23. September anzutreffen. Ganz grob betrachtet wirkt dieser umbaute öffentliche Aussenraum auf mich ruhig, einladend und entspannt. Der Eindruck, sich zwischen Strassen und Gebäuden zu befinden schwindet kurz nach dem Betreten des Raums. Die Erscheinung ist natürlich stark abhängig vom Wetter und der Tageszeit. Im schlechten Wetter bietet der Platz keine Unterschlüpfe an und ist in dieser Zeit somit eher düster und Menschenleer. In der Nacht erhält man auch einen ganz neuen Eindruck, was am Tag noch Familienfreundlich und einladend wirkte, ist in der Nacht eher das Gegenteil. Teilweise schlecht Beleuchtet und von Partygängern bestückt ist diese Situation für manch einen wohl eher düster und abweisend.

Kontext / Geschichte
Der Name Vögeligärtli stammt von der im Jahre 1901 im Park errichteten Volière (grosser Vogelkäfig). Früher hatte dieser Park auch schon andere Namen getragen, wie Sempacherplatz, Sempachergarten, Englischer Garten, Zentralplatz oder Zentralmatte. Entstanden ist der Park 1899. Grund dafür war die Verschiebung der damals an diesem Standort befindlichen Gasfabrik vom Sempacherplatz. Historisch gesehen war das Vögeligärtli schon immer ein sehr belebter Platz. Seit jeher war dies ein Ort an dem Schausteller und Budenbetreiber das Volk unterhielten. Auch der Zirkus Pilatus und die Arena Bühlmann hatten ihre Auftritte im Vogeligärtli. In den Sommermonaten wird der Park heutzutage auch als Aufführungsort für Konzerte verwendet.



Historische Kartenreise:





Beobachtungen / Technisches
Grundsätzlich handelt es sich beim Raum 7 um einen umbauten öffentlichen Raum. Raum 7 hat eine rechteckige Form und wird auf allen Seiten durch eine Strasse abgegrenzt. Jeweils auf den Park abgewandten Seiten der Strassen befinden sich diverse Gebäude. Der Park setzt sich aus asphaltierten Wegen und Plätzen, Rasenflächen, Bäumen, Pflanzen, Spielplätzen, Sitzgelegenheiten, Sanitäranlagen und einem Restaurant zusammen. Die Beleuchtung des Platzes geschieht am Tag durch natürlich einfallendes Licht, welches durch die nebenstehenden Gebäude und Bäume zum Teil zurückgehalten wird und somit Schattenplätze erschafft. In der Nacht wird der Park durch künstliches Licht erhellt. Zum Teil sind Lampen an Drahtseilen einige Meter über Boden befestigt, anderseits gibt es Kandelaber an den Rändern welche auch der Strassenbeleuchtung dienen. Bei den Oberflächen handelt es sich um versiegelte und versickerungsfähige Oberflächen. Das heisst bei den Rasenflächen sollte das Regenwasser problemlos versickern können, hingegen das Wasser welches auf den belagten Flächen ansteht wird über Entwässerungsschächte gesammelt und abgeführt.

Quellenverzeichnis:
Wie ich das Vögeligärtli erlebte
Y. Thürlemann
Für das Schulfach Mensch und Raum durfte ich das Vögeligärtli in Luzern besuchen. Das Ziel dieses Besuches ist es, meine subjektiven und objektiven Beobachtungen in diesem Text zusammenzufassen.
Ich besuchte den Park gegen die Abendzeit, die Stimmung war sehr gemütlich und der Park war mit vielen Besuchern gefüllt. Der Ersteindruck hat mich sehr positiv gestimmt, da ich überrascht war wie viele Leute sich in dem Park befanden. Grundsätzlich machte er einen einladenden und gemütlichen Eindruck, dies war aber auch dem Wetter zu verdanken. Der Park ist darum immer auf das natürliche Licht der Sonne angewiesen, somit bestimmen grösstenteils Wetter- und Lichtverhältnisse wie man den Park erlebt.

Der Park ist circa 60m mal 60m gross. Umgeben ist dieser grösstenteils von Wohnhäusern, neben diesen Wohnhäusern gibt es noch eine Kirche und die Zentralbibliothek. Die Grundfläche des Parks habe ich in fünf Teile unterteilt, der grösste Teil besteht aus einer Wiese. Neben dieser gibt es einen Spielplatz, Gehwege, Imbissstand und einen Asphaltplatz. Im Park verteilt stehen grosse Bäume, diese bieten genügend Schattenplätze für Besucher. Der Spielplatz selbst besteht aus Holzkonstruktionen, an diesen sind Metallstangen und Netze angebracht. Die Gehwege führen am Rande des Parkes einmal um die Wiese herum und sind mit ein paar Lampen versehen. Ich konnte nicht sehr viele künstliche Lichtquellen im Park ausmachen, darum gehe ich davon aus das dieser in der Nacht nicht sehr gut beleuchtet ist. Der Asphaltplatz macht den zweitgrössten Teil des Parkes aus, auf diesem gibt es unterschiedlichste Aktivitäten. Dazu gehören zwei Schachbretter mit den entsprechenden Figuren. Neben den Schachbrettern gibt es noch ein Mühlespielfeld und zwei Pingpongtische. Zusätzlich zu den Sitzgelegenheiten gibt es noch einen Brunnen als Trinkgelegenheit. Aus Ingenieurssicht ist die Beschaffenheit der Oberflächen zu beachten. Auf der Wiese versickert das Regenwasser, dies ist beim Asphalt aber nicht möglich. Durch die geschlossene Oberfläche wurden beim Asphalt unterschiedliche Gefälle eingeplant, diese haben das Ziel das Wasser zu den Schächten zu führen. Durch die Schächte gelangt das Wasser in die Kanalisation und wird so kontrolliert abgeführt. Diese zwei Oberflächen sind durch Bordsteine abgetrennt, der Asphalt wurde dabei circa 2cm tiefer verlegt. Durch diese Differenz fliesst überschüssiges Wasser, welches von der Wiese nicht genug schnell abtransportiert werden kann, auf die Ebene des Asphaltes. Das Wasser wird anschliessend auch gezielt durch die Kanalisation abgeführt.

Der Platz für das Vögeligärtli entstand 1899 durch das verlegen der sogenannten Gasfabrik. Anschliessend wurde der Platz von Schaustellern genutzt, dazu gehörten der Zirkus Pilatus und die Arena Bühlmann. Im verlaufe der Zeit wurde der Platz kleiner, da teile dazu genutzt wurden die Lukaskirche und die Zentralbibliothek zu bauen. Namensgebend für das Vögeligärtli war ein Volière, welches von 1908 bis 1954 im Vögeligärtli stand.


Abschliessend kann ich sagen das, dass Vögeligärtli mit den geeigneten Wetter- und Lichtbedingungen ein sehr einladender und erholsamer Ort ist. Ich stelle mir den Park in der Nacht aber nicht sehr einladend vor, da die Lampen nur sporadisch verteilt sind. Diese sahen zusätzlich auch nicht gerade danach aus, eine grosse Leuchtkraft zu besitzen.
Quellenverzeichnis: