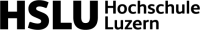Ein zentraler Aspekt im Forschungsdatenmanagement (FDM)-Zyklus ist die sichere und strukturierte Speicherung von Daten, um deren Integrität, Zugänglichkeit und Nachnutzbarkeit zu gewährleisten.
Welche Optionen bietet/empfiehlt die HSLU zur Speicherung der Daten?:
Wie kann ich mich vor Datenverlust schützen?
Um sich vor Datenverlust zu schützen, ist es wichtig, regelmässige Backups Ihrer Daten auf verschiedenen Speichermedien durchzuführen. Hierfür eignet sich die 3-2-1-Regel:
Erstellen Sie drei Kopien Ihrer Daten, speichern Sie zwei davon auf unterschiedlichen Medientypen und bewahren Sie eine Kopie an einem externen Standort auf.
Zugriffs-, Schreib- und Löschrechte sollten je nach Speichermedium und Verantwortlichkeiten festgelegt werden. Dies gewährleistet eine klare Kontrolle über den Datenzugang und verhindert unbefugte Änderungen oder Löschungen der Daten
Dadurch minimieren Sie das Risiko, dass wichtige Daten durch technische Defekte, menschliche Fehler oder andere unvorhersehbare Ereignisse verloren gehen. Wie z.B. bei Pixar, wo durch einen Fehler bei der Speicherung beinahe der zweite Teil von Toy Story verloren ging:
Pixar Deleted Toy Story 2: How a Baby Saved the Sequel (youtube.com)
Wozu benötigen meine Forschungsergebnisse Metadaten?
Metadaten erleichtern die Auffindbarkeit der Forschungsdaten. Darüber hinaus ermöglichen sie den Vergleich von Datensätzen unterschiedlicher Herkunft, was besonders in interdisziplinären oder gross angelegten Forschungsprojekten von Bedeutung sein kann. Diese standardisierte Dokumentation unterstützt zudem die Durchführung von Meta-Analysen, bei denen Forschungsergebnisse aus verschiedenen Studien zusammengeführt und analysiert werden, um umfassendere Erkenntnisse zu gewinnen. Somit tragen Metadaten zur Verknüpfung und Wiederverwendung von Daten in der wissenschaftlichen Forschung bei.
Mit welchen Metadaten sollte ich meine Forschungsergebnisse ausweisen?
Metadaten sollten idealerweise die folgenden Angaben enthalten:
- Inhaltliche Metadaten: Urheber/in, Titel, Schlagwörter, Thema,
- Methodische Metadaten: Untersuchungsdesign, Erhebungsmethode
- Formale Metadaten: Dateityp, Dateiformat, Dateigröße
- Administrativ-technische Metadaten: Bereitstellungsdatum, Bearbeitungsdatum, Bearbeiter, Systemanforderungen
- Relationale Metadaten: Verweise auf Kontextmaterialien (Transkripte), Literatur
- Identifizierende Metadaten: z.B. Digital Object Identifier
- Rechtliche Metadaten: Anonymisierungsgrad, Zugangskonditionen, Lizenzen
Eine Übersicht von Metadaten-Standards in verschiedenen Disziplinen